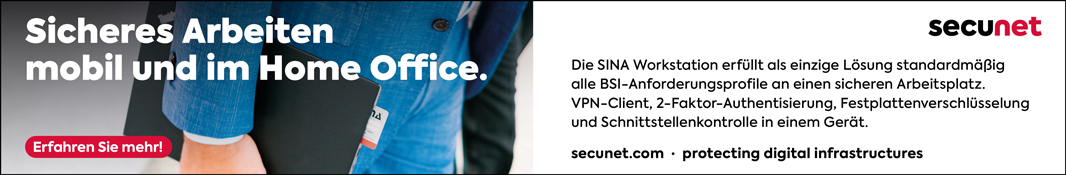Smartphone-Bürger-ID aus Gelsenkirchen und Aachen
⟩⟩⟩ von Matthias Lorenz, Behörden Spiegel
Ein großes Hemmnis für die Digitalisierung von Verwaltungsleistungen stellen rechtliche Hürden wie zum Beispiel Unterschrifterfordernisse dar. Abhilfe könnte hier die digitale Identifikation, meist mittels des Smartphones, schaffen. Bisherige Lösungen werden allerdings kaum genutzt. In Gelsenkirchen jedoch wurde ein Projekt realisiert, welches die Smartphone-Identifikation stark erleichtern soll. Der Anschluss an das NRW-Serviceportal folgt in Kürze.

Bisher tat sich die Bundespolitik schwer, digitale Identifikationsmöglichkeiten praktikabel zu gestalten. Lediglich 35 Prozent der Bürgerinnen und Bürger haben die Online-Ausweisfunktion des Personalausweises einsatzbereit, nur neun Prozent (!) haben die Funktion bislang genutzt. Dies ergab der eGovernment Monitor der Initiative D21 und der TU München. Mit dem Projekt der Smart-eID wollte die alte Bundesregierung den Nutzungsgrad der Online-Identifikation erhöhen. Diese ermöglicht es, sich nur noch mit dem Smartphone (also ohne den Personalausweis) auszuweisen. Doch die Technik läuft zunächst nur auf einer Reihe von Smartphone-Modellen der Firma Samsung.
Mit vielen Geräten kompatibel
Genau hier sieht Oliver Kazmierski von der Stabstelle Digitale Stadt Gelsenkirchen einen der Vorteile der gemeinsam mit der Stadt Aachen und anderen Projektpartnern entwickelten „Smartphone-Bürger-ID”. „Die Tatsache, dass unsere Anwendung auf fast allen Smartphones läuft, macht die Lösung aktuell deutlich attraktiver”, sagte der Leiter des Projekts aufseiten der Stadt Gelsenkirchen beim e-nrw-Kongress. Ziel sei es von vorneherein gewesen, eine digitale Identität zu schaffen, die ähnlich einfach nutzbar sei wie Lösungen großer Tech-Konzerne, zum Beispiel Amazon oder Apple.
Die von den Projektpartnern entwickelte Anwendung eignet sich im Gegensatz zur Online-Ausweisfunktion des Personalausweises zwar nur zur Authentifizierung bei Leistungen, die das in der eIDAS-Verordnung der EU festgelegte Vertrauensniveau „substanziell” benötigen. “Die meisten Dienstleistungen können aber mit diesem Vertrauensniveau erledigt werden”, erklärt Kazmierski. Die noch darüberliegende Vertrauensstufe „hoch” werde längst nicht immer benötigt. Sobald der Personalausweis in die App eingelesen sei, könnten die Anwender sich allein mit ihrem Smartphone unter Einhaltung des Vertrauensniveaus „substanziell” identifizieren. Der Freigabeprozess sei dabei immer gleich, zum Beispiel über einen Fingerabdruck oder Gesichtserkennung.
Mehrere Trigger
Darüber hinaus, so Kazmierskis Erläuterungen weiter, könne die Bürger-ID durch mehrere Trigger ausgelöst werden. Normalerweise sei dies das Einlesen eines QR-Codes, beispielsweise auf einem Online-Antrag. Darüber hinaus gebe es aber noch weitere Trigger wie zum Beispiel eine NFC-Schnittstelle. „Deswegen gibt es für die Anwendung im Smart-City-Bereich auch interessante Einsatzgebiete abseits von Behördengängen”, sagt Kazmierski. So könnten Türschlösser mittels der App geöffnet werden, auch die Nutzung bei Bürgerbeteiligungen und die Einrichtung von Storage-Boxen, in denen Bürgerinnen und Bürger Bescheide abseits von Verwaltungsöffnungszeiten abholen könnten, seien denkbar.
In Kürze soll das Projekt an das Servicekonto NRW angeschlossen werden. Dort firmiert es dann unter dem Namen „Servicekonto.Pass”. Damit wird die Authentifizierungsmöglichkeit für alle Bürgerinnen und Bürger, die ein Nutzerkonto beim Servicekonto NRW haben, nutzbar. Für wie viele Verwaltungsleistungen die Anwendung dann letztendlich nutzbar sein wird, hängt allerdings auch davon ab, wie schnell Digitalisierungshemmnisse wie Schriftform- oder Unterschrifterfordernisse abgebaut werden. „Es ist doch nur eine historisch bedingte Frage, was wir als Authentifizierung akzeptieren”, führt Dr. Marc Schrameyer, Bürgermeister der Stadt Ibbenbüren, die digitale Modellkommune war, in diesem Kontext aus. „Heutzutage gibt es viel sicherere Merkmale als eine Unterschrift.” Es sei also nur die Frage, ob der Gesetzgeber diese ersetzen wolle oder nicht. Der Wille hierzu sei bisher noch nicht erkennbar. Dr. Schrameyer wünscht sich eine bundesweit einheitliche eID, die für alle nutzbar ist. „Dann hätten wir richtig gewonnen und wären einen großen Schritt weiter.”